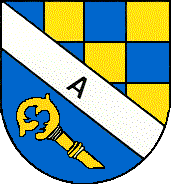Geschichte
Die Reichhaltigkeit des Urkundenmaterials zur Geschichte des Ortes Auen - gemessen an der Größe und der Bevölkerungzahl - scheint fast übertrieben und lässt sich aber durch die Zugehörigkeit des Ortes zum Kloster Sponheim und der Willigiskapelle zum Kloster Disibodenberg recht gut erklären.
Die Annahme, dass Auen in der Landnahme Zeit um 900 entstanden sei, lässt sich nach den neusten Erkenntnissen nicht mehr aufrecht erhalten, da die archäologischen Funde eine teils permanente Besiedlung schon in früherer Zeit anzeigen. Wenn bei röm. Ausgrabungen auch, und das bei allen Grabungen, keltisches Material gefunden wird, so lässt das darauf schließen, dass das Auenertal schon seit der Jungsteinzeit besiedelt war.
Auen wird erstmals in der Bestätigungsurkunde von Erzbischof Adalbert aus Mainz im Jahre 1128 in Verbindung mit dem Bau der Willigskapelle um 980-990 erwähnt. Bereits 1044 und 1048 in den Schenkungsurkunden des Grafen Eberhard von Sponheim an die Kirche zu Sponheim - in Auen vier Huben mit ihrem vierten Teil - wird der Ort aufgeführt.
1203 wurde Auen dem Kloster Sponheim als Lohn verschenkt mit Land und Leuten, da der Abt während des Kreuzzuges des Grafen über seine Grafschaft bestens gewacht hatte.
Die lange Zugehörigkeit zum Kloster Sponheim wird im Auener Weistum (historische Rechtsquelle) von 1488 und der Huldigung des Abtes Tritemius um 1500 bestätigt, sie dürfte bis 1570 gedauert haben. Durch diese Zugehörigkeit zum Kloster Sponheim kam Auen zum Oberamt Kreuznach und wird in der Amtsbeschreibung von 1601 wie folgt erwähnt. "Zum Oberamt Kreuznach gehören unter anderem die Grundherrschaft der Abtei Sponheim sowie das abgelegene Dorf Auen", das damals schon Exklave zwischen den anderen Ämtern war. Auch wird erwähnt, dass Auen im Umfang des Amtes Böckelheim lag aber dem Oberamt Kreuznach mit aller Botmäßigkeit unterworfen war.
Gleichzeitig unterstanden die Auener Bürger religiös der Pfarrei Geh in Kirche, die wiederum dem Kloster Disibodenberg. Die Auener kamen mit diesen beiden Abhängigkeiten relativ gut zurecht. Um 1550 wird die Reformation eingeführt, der letzte Pfarrer Venter verlässt die Pfarrei Getzbach und wird erster protestantischer Pfarrer in Pferdsfeld. 1575 wird der Getzbacher Wald verkauft, hierdurch verliert Auen seine Gemarkungsteile, die bis zum Hummerstuhl reichten, und fast die Hälfte der heutigen Gemarkung ausmachten.
1707 kam Auen zur Kurpfalz, noch immer zum Oberamt Kreuznach gehörend, bis in die Napolionische Zeit. Einige Jahre zur Maire Monzingen gehörend, kam es 1815 zum Preußischen Amt Monzingen von wo es 154 Jahre verwaltet wurde. Durch die Verwaltungsreform 1969 wurde Auen der Verbandsgemeinde Sobernheim zugeteilt. Auen war immer ein kleines Dorf, das nie über seinen Schatten hinauskam. Die Bevölkerungszahlen bewegten sich 1437/1438, 8 Herdstätten, 1580-1600, 81 Einwohner in 18 Herdstätten, 1808 152 Bürger, 1939 193 und heute 189. Näheres ist in der Auener Chronik Seite 85 nachzulesen.
Im Jahre 1993 wurde die Auener Chronik - ein Werk von 232 Seiten - der Bevölkerung vorgestellt. Aus dem Vorwort erfahren wir, dass es den Rahmen der Ortsgeschichte bei Weitem überschritten hätte, hätte man alle gesammelten Unterlagen zur Vorgeschichte entsprechend ihrem Umfang darstellen wollen. Eine geringe Anzahl der Chronik ist noch verfügbar und beim Bürgermeister erhältlich.
Auen hat sich in den letzten Jahren zu einer Wohngemeinde, dem Fremdenverkehr angepasst entwickelt, die ihren landwirtschaftlichen Charakter noch nicht verloren hat.
Archäologische Fundstellen
Auen war bis nach dem zweiten Weltkrieg ein weißer Fleck in punkto Archäologischer Funde im Kreis Bad Kreuznach. Man wusste schon von einigen Fundstellen, aber es waren noch keine Grabungen oder Aufzeichnungen vorhanden. Durch ständiges Beobachten und darauf folgende Grabungen konnten bisher 22 Fundstellen ermittelt werden. Alle Ausgrabungen erfolgten unter Aufsicht des Amtes für Bodendenkmalpflege in Mainz.
Steinbeile u. Keramik ca. 3500-2000 v. Chr.
Zwei ausgebrannte Holzbrunnen aus keltischer Zeit
Mahlstein aus keltischer Zeit
Weinkern, Weizen und Gerstenkörner aus der Latene Zeit
Großes Tongefäß aus der Hallstadt Zeit
Fundstücke bei der Willigiskapelle aus der keltisch römischen Zeit.
Vier römische Wasserleitungen.
Kopf einer römischen Ampora
Römischer Fund eines Hauses mit Abwasserleitung.
Römischer Münzfund ca. 200 n.Chr.
Verschiedene Stellen mit römischen Scherben
Elfenbein Kreuz um 1300
Zwei Stellen mit römischen Gefäßen
Acht Sandsteinbrüche
Zwei Kalköfen
Eine Kohlengrube und weitere Schürfungen.
Genealogie
Die von Auen vorhandene Kirchenbücher sind verkartet und in einem Buch von 248 Seiten zusammen gefasst.
Der Name des Ortes Auen
- 1047: Auwen
- 1124: Auwen
- 1488: Dorff Awen
- 1588: Awen
- 1601: Dörflein Awen
- 1720: Gemeind Awen
- 1731: Auwen
- 1758: Auen
- 1761: Auen, ist ein Stellenname der eine Ansiedlung oder ein Gehöft bezeichnet
Erst ab Mitte des 18. Jhd. setzte sich die heutige Schreibweise AUEN durch. Vom germanisch I keltischen
dhwö, idg I akua f. Wasser, a(z)wjö f. Insel. Verwandt mit dem lateinischen ahd, auw(i)a aqua f. Wasser,
Land am, im oder beim Wasser. Abgeleitet auch f. fette Wiese am Bach, Aue in Auen.
Weitere Orte mit dem Namen
- Auen b. Cloppenburg (Emsland)
- Auen am Wörtersee / Östereich
- Auen bei Bruck an der Mur / Östereich
- Auen / Kuschma in Rumänien
- Auen an der Save / Slowenien
Kleiner Rückblick
Obwohl Auen ein sehr alter Ort ist, entwickelte er sich erst im 19. Jahrhundert zu einem der Landwirtschaft und Weinbau betreibenden Orte im Naheraum. Das Anlegen von Weinbergen versprach einen guten Nebenerwerb, obwohl schon ein Weinkern mit Getreidekörnern aus dem 1500 Jh. vor Chr hier gefunden wurden. Auch das Steinhauerhandwerk in den Steinbrüchen um Auen florierte. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden fertig geschlagene Kapitelle und Steine an den Kölner Dom geliefert. 39 kleinere landwirtschaftliche Betriebe erwirtschafteten das zum Leben Notwendigste. Neue und leichter befahrbare Feldwege wurden angelegt, sie sollten zur Erleichterung der Feldarbeit beitragen. Einige Bauern erhielten um 1900 Zertifikate für ihre guten Erzeugnisse.
Seit 1770 wanderten 31 Bürger aus.
Der erste Weltkrieg forderte von 180 Einwohnern acht Gefallene und zwei Vermisste.
Im zweiten Weltkrieg sind von 56 Soldaten 23 gefallen und 4 vermisst.